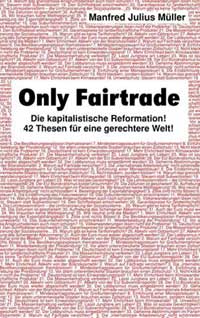
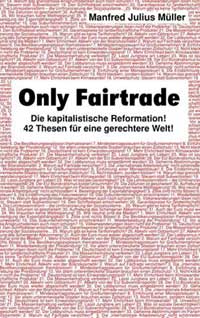
Die
Zähmung des Kapitalismus!
Die
kapitalistische Reformation!
Kapitel
II:
Die
Macht der Konzerne einschränken!
Die 8.
These:
Mindestertragssteuern
für Großunternehmen!
Viele internationale Konzerne mit Milliardenumsätzen in Deutschland zahlen hier keine oder nur geringe Ertragssteuern (weil sie ausgerechnet hier angeblich keine Gewinne erwirtschaften). Wieviele Jahrzehnte schaut man sich dieses skandalöse Treiben nun schon an? Warum müssen nicht grundsätzlich Unternehmen, die im Jahr mehr als 100 Millionen Euro in Deutschland umsetzen, als unterste Grenze eine drei- oder vierprozentige Mindestertragssteuer entrichten? Dann könnten sich so manche den dubiosen Zirkus mit anrüchigen Steueroasen ersparen.
Wer als Großkonzern nicht in der Lage ist, nachhaltige Gewinne zu erzielen, hat meines Erachtens in einem kapitalistischen System keine Daseinsberechtigung. Es ist nicht einzusehen, warum solche wirtschaftlichen Zombies allein aufgrund ihrer Größe seriöse, steuerzahlende Mittelständler plattmachen. Die Gewinnerzielung gehört zum Grundprinzip des Kapitalismus. Konzerne, die dieses System unterwandern, schaden weit mehr als sie nutzen, sie mutieren zum Krebsgeschwür einer Marktwirtschaft.
Die 9.
These:
Einführung
einer Monopolsteuer!
Ständig ist vom fairen Wettbewerb und von einer Chancengleichheit die Rede. Wie aber sieht die Wirklichkeit aus? Wie kann ein mittelständisches Unternehmen mit 50 Beschäftigten gegen einen Konzern mit 10.000 Mitarbeitern bestehen? Schon im Steuerbereich ist der Konzern dem Mittelständler haushoch überlegen. Weil er internationale Schlupflöcher nutzen und sich ein Team der besten Steuerexperten leisten kann. Auch Subventionen kann ein Großunternehmen mit seinen Spezialistenteams besser abgreifen. Und was die Standortbedingungen betrifft (Verkehrsanbindung, günstige Gewerbegrundstücke, unterstützende Forschungen an den Universitäten usw.) wird den Giganten natürlich auch ganz anders unter die Arme gegriffen.
All diese marktverzerrenden Privilegien rechtfertigen meines Erachtens eine Art Monopolsteuer, die auf heimische und importierte Produkte (und Dienstleistungen) der Wirtschaftsriesen aufgeschlagen wird. Durch dieses System bleibt der Standort Deutschland unbelastet und niemand kann sich durch ein Outsourcing aus der Sache herausmogeln.
Sowohl die Monopol- als auch die Mindestertragssteuer sind beidermaßen wichtig. Man sollte sie nicht in einer Steuer vereinen, weil sie unabhängig voneinander greifen und weil sie ein Gradmesser dafür sind, wie unbestechliche Politiker und Regierungen sich ernsthaft für die Kultivierung des Kapitals einsetzen. Die Mindestertragssteuer braucht man, um unrentable Firmen aus dem Rennen zu nehmen (um den natürlichen Regenerierungsprozess zu bewahren) bzw. das Parasitentum (die Steueroasen) auszutrocknen. Konzerne sollen angemessene Ertragssteuern zahlen - so wie es bei den Mittelständlern ganz selbstverständlich ist. Das ist ein logischer Akt der Gerechtigkeit! Und die Monopolsteuer ist eben dazu da, die Übermacht der Konzerne, die sich aus dem Kapitalismus leider zwangsläufig ergibt, auszugleichen. Wer eine faire Marktwirtschaft will, wird kaum umhin kommen, in diese Richtung zu denken und zu handeln. Sonst wird die Welt in wenigen Jahrzehnten beherrscht von multinationalen Konzernen, die unsere Regierungen zu Marionetten degradieren.
Die 10.
These:
Niederlassungspflicht
für größere Firmen!
Der Trend ist eindeutig: Immer mehr Firmen schließen ihre Niederlassung in Deutschland und beliefern und betreuen ihre Kundschaft von einer ausländischen Zentrale. Das ist äußerst kundenfeindlich! Zum Beispiel wenn falsch gelieferte oder defekte Ware ins Ausland zurückgeschickt werden muss, die Kundenbetreuer im Ausland die deutsche Sprache nicht beherrschen oder nur widerwillig auf berechtigte Reklamationen reagieren (sich penetrant dumm stellen).
Aber nicht nur die Kunden haben erhebliche Nachteile, auch der Staat hat das Nachsehen. Weil er ein weiteres Stück seiner Kontrollmöglichkeiten beraubt wird. Denn die in Deutschland getätigten Umsätze lassen sich natürlich schwieriger erfassen, wenn die Belieferung von einer ausländischen Zentrale erfolgt und deutsche Kunden den Rechnungsbetrag auf ausländische Konten überweisen müssen.
Deshalb folgender Vorschlag: Ausländische Firmen, die hierzulande einen Umsatz von mehr als drei Millionen Euro erzielen, werden verpflichtet, auch hier eine Niederlassung zu unterhalten. Die Kunden überweisen die fälligen Rechnungen dann also auf die deutschen Konten der heimischen Niederlassung. Damit wären zahlreiche Schummeleien und Steuertricksereien ausgeschlossen. Auch die Monopol- und Mindestertragssteuern ließen sich dann ganz einfach ermitteln.
Die 11.
These:
Unternehmerische
Unkultur beenden!
Wie kann es sein, dass einige Weltkonzerne telefonisch nicht erreichbar sind? Man kann auf deren Websites stundenlang suchen und findet nicht eine einzige Telefonnummer, nicht mal im Impressum. Und falls dort doch eine Nummer auftaucht, bekommt man es oft mit einem Automaten zu tun (der einem nur die Zeit stiehlt und selten weiterhelfen kann). Manche Konzerne verstecken sogar ihre Emailadresse! Sie bieten als lausigen Ersatz lediglich Kontaktformulare, die nur standardisierte Fragen zulassen und individuelle Anliegen abblocken. Oft habe ich es auch erlebt, dass Weltkonzerne zwar eine Emailadresse angeben, auf gezielte Anfragen aber überhaupt nicht reagieren. Man kann nachhaken so oft man will - nie bekommt man eine Antwort. Warum lässt der Gesetzgeber eine solche Abschottung zu? Wieso dürfen Großkonzerne Sonderrechte genießen? Könnte eine mittelständische Firma es sich erlauben, seine Kunden derart zu verprellen?
Letztens hat ein Kunde von mir eine Internetbestellung widerrufen, weil er außerhalb der Geschäftszeiten telefonisch niemand erreichen konnte (er hätte zum bestellten Artikel noch eine Frage gehabt). Empört berichtete er, dass er den Artikel dann bei einem großen Konzern bestellt habe. Doch ich weiß genau, dass dieser Konzern zu den Abschottern zählt (keine Telefonnummer, keine Möglichkeit gezielter Anfragen per Email). Das ist schon lustig und zeigt, wie sehr auch die Verbraucher mit zweierlei Maß messen.
Wieso kann unser Staat sich kommunikativ abschottende Großkonzerne nicht zur Räson bringen, wieso kann er nicht die Preisgabe einer verbraucherfreundlichen Telefonverbindung im Impressum verlangen? Braucht unser Land Firmen, die dem Kunden eine harmlose Anfrage nahezu unmöglich machen? Und warum muss es überhaupt fremde Callcenter geben, als Subunternehmen, fernab von der Firmenzentrale, womöglich noch im Ausland? Kann ein großes Unternehmen nicht eigene Telefonisten einstellen? Die Unsitten der Konzerne breiten sich aus und der Gesetzgeber schaut gelassen zu, während er die Mittelständler mit immer neuen Verfügungen traktiert. Und dann beklagen unsere Politiker auch noch scheinheilig den Monopolisierungstrend.
Bei all diesen in meinen Augen unseriösen Machenschaften berufen sich Konzernchefs gerne auf die internationale Konkurrenz - man müsse sparen, um mithalten zu können. Aber das zeigt doch einmal mehr, in welch absurde Zwangslage uns die „internationale Arbeitsteilung" und die Exportabhängigkeit bringen. Warum lernt man nicht daraus, warum verteufelt man noch immer das faire Verhältnisse schaffende Zollsystem?
Die 12.
These:
Die
Eindämmung des Filialunwesens!
Ist es für den Verbraucher von Vorteil, wenn sich einige wenige Handels-, Gastronomie-, Hotel- oder Dienstleistungsketten den Markt in Deutschland untereinander aufteilen und inhabergeführte Geschäfte zur Rarität oder zum Kuriosum verkommen?
Wir beklagen mit Recht die Monotonie in unseren Innenstädten, die einhergeht mit der Standardisierung des Angebots. Aber wir machen uns selten Gedanken darüber, was dieses Artensterben eigentlich für den freien Wettbewerb bedeutet. Ist es wirklich so toll, wenn man in jeder Stadt die gleichen Hamburger bekommt, die gleichen Pizzen, die gleichen Lebensmittel, Kleider und Schuhe? Wie erpressbar sind Hersteller, wenn ein Großabnehmer droht, Sortimente aus dem Programm zu nehmen (falls der Lieferant nicht Sonderrabatte gewährt, Werbungskosten übernimmt, Regalmieten zahlt)? Ganz ehrlich: Ich halte die Entwicklung der letzten vier Jahrzehnte für eine Perversion - einer modernen, humanen Zivilgesellschaft unwürdig.
Warum wurde nicht längst gegengesteuert und eine gestaffelte Filialsteuer eingeführt? Etwa so: Ab 30 Filialen eine zusätzliche Umsatzsteuer von drei Prozent, ab 100 Filialen eine von fünf Prozent und ab 500 Filialen eine von sieben Prozent. Gesunde Großfilialisten würden mit dieser Zusatzabgabe klarkommen - kränkelnde Unternehmen der leistungsfähigeren Konkurrenz bzw. innovativen Einzelhändlern Platz machen.
Verringert sich für den Verbraucher durch eine Filialsteuer die Kaufkraft bzw. der Lebensstandard? Mitnichten! Denn die zusätzlichen Einnahmen werden ja nicht verbrannt oder veruntreut. Die Einnahmen würden sinnvollerweise verwendet, die hohen Sozialversicherungsbeiträge abzusenken (den Sozialstaat mehr über Steuern zu finanzieren).
Die 13.
These:
Das
Subunternehmertum einschränken!
Wie drückt man erfolgreich die Lohnkosten im ständig tobenden Verdrängungswettbewerb? Es wundert nicht, wenn Großunternehmen im unentwegten Überlebenskampf auf die Idee kommen, wichtige Bestandteile ihres Geschäfts in tariflich ungebundene Subunternehmen auszulagern, die dann wiederum wichtige Aufgaben an Scheinselbständige delegieren. Wie perfekt dieses System funktioniert, kann man am besten bei den Paketdiensten beobachten.
Natürlich könnte der Gesetzgeber eingreifen und diesen Wildwuchs erfolgreich bekämpfen. Den betroffenen Konzernen käme ein solches Gesetz vielleicht nicht einmal ungelegen. Es könnte durchaus sein, dass auch sie lieber anständige Löhne zahlen (was aber der harte Konkurrenzkampf bislang nicht zulässt). Würden alle Mitbewerber sich an geltende Tarife halten müssen, hätte niemand das Nachsehen. Sollte etwas durch faire Löhne teurer werden, wird sich das Kaufverhalten vielleicht geringfügig ändern. Das aber ist nun einmal auch das Prinzip einer Marktwirtschaft - der unmanipulierte Preis soll die Nachfrage steuern. Damit erzielt man die höchstmögliche Effizienz und Produktivität - also den größtmöglichen Wohlstand.
Die 14.
These:
Unseriöse
Geschäftsübernahmen erschweren!
Immer wieder liest man, wie Spekulanten mit überwiegend geliehenem Geld große Firmen aufkaufen. Das dreiste daran: Die hohen Kredite für die Kaufsumme werden einfach der übernommenen Firma aufgebürdet! Und diese brechen dann oft unter der Last ihrer Schulden irgendwann zusammen. Sie stellen dann in der Regel einen Insolvenzantrag bzw. beantragen Gläubigerschutz, um mit derlei Tricks einen Teil ihrer Schulden loszuwerden bzw. um ohne große Abfindung Teile der Belegschaft entlassen zu können. Warum werden Geschäftsübernahmen, die der Investor nicht selbst stemmen kann, überhaupt genehmigt? Ist es im Interesse der Bevölkerung, die Monopolisierung voranzutreiben und einige wenige Spekulanten reich zu machen (auf Kosten der Lieferanten und Mitarbeiter, die bei einer Pleite leer ausgehen)? Wozu haben wir denn eine Kartellbehörde?
Die 15.
These:
Wiederbelebung
der Preisbindung!
Bis in die 1970er Jahre hinein galt in Deutschland in vielen Bereichen eine strikte Preisbindung (die gibt es heute nur noch bei Büchern und Zeitschriften). Der Hersteller bestimmte die Verkaufspreise und alle Händler hatten sich danach zu richten. Preisschlachten, wie wir sie heute erleben, gab es damals nicht. Hat nun die Aufhebung der Preisbindung dem Verbraucher etwas gebracht, wurden die Waren dadurch billiger?
Nein, eigentlich nicht. Erstaunlicherweise! Denn aus der Freigabe entwickelte sich ein irrer (kontraproduktiver) Verdrängungswettbewerb, den vor allem die Großfilialisten überlebt haben (die meisten inhabergeführten Existenzen wurden vernichtet). Noch heute werden Unsummen in die Werbung und ins Marketing gesteckt (volkswirtschaftlich gesehen weitgehend verbranntes Geld).
Besonders gravierend sind die Auswirkungen auf die Lebensqualität der Konsumenten. Sie befinden sich nunmehr in einer permanenten Stresssituation, müssen viel Zeit vergeuden, um Prospekte zu studieren und Preise zu vergleichen - um ja nicht „zu viel" zu bezahlen. Und die fachliche Beratung bleibt dabei weitgehend auf der Strecke (bei den mageren Renditen ist diese kaum noch bezahlbar).
Weitere böse Auswirkungen: Den Tante-Emma-Laden um die Ecke gibt's schon lange nicht mehr (den kleinen Plausch mit dem Kaufmann auch nicht). Selbst hochbetagte Rentner sind heute bei ihrem Einkauf weitgehend auf ein Auto angewiesen (eine schwere Hypothek bezüglich Städteplanung und Umweltbelastung).
Durch die Aufhebung der Preisbindung können Handelsriesen regionale Hersteller dermaßen unter Druck setzen, dass viele von ihnen keine gesunden Renditen mehr erwirtschaften (also auf Gedeih und Verderb den Großabnehmern ausgeliefert sind).
Weiterer Druck wird inzwischen über das Internet aufgebaut. Seit 40 Jahren bin ich Inhaber eines Versandhauses für Fotozubehör. Meine Erfahrungen: Es gibt vermutlich kaum einen Fotoartikel, der in den „Preissuchmaschinen" nicht 10 oder 20 Prozent unter dem regulären deutschen Händlereinkaufspreis an den Endverbraucher verhökert wird.
Wie das funktioniert? „Findige" Händler kaufen irgendwo in der Welt Grauimporte und Überbestände, bekommen dabei oft aber Produktfälschungen oder II.-Wahl-Artikel untergeschoben. Oder sie entledigen sich über getürkte Exporte (Karussellgeschäfte) der leidigen Mehrwertsteuer. Oder sie missbrauchen ihren Einkaufsvorteil als Generalimporteur (der sie verpflichtet, in ihrem Heimatland ein Vertriebsnetz aufzubauen, die Produkte zu bewerben, die Händler zu betreuen und Garantieansprüche zu erfüllen), um vertragswidrig (entgegen dem üblichen Gebietsschutz) mit einem eigenen Ver-sandshop in einem Nachbarstaat zu wildern.
Schon heute gehen dem deutschen Fiskus jährlich hohe Milliardensummen durch ausländische Versender verloren. Falls der Staat nicht eingreift kann es durchaus sein, dass es in 20 Jahren in vielen Bereichen kaum noch seriöse Händler in Deutschland gibt und ein Großteil der Ware über ausländische Versender ins Land gelangt, vorbei am deutschen Fiskus. Zur Kompensierung der fehlenden Mehrwertsteuer-Einnahmen müsste dann vermutlich die Lohn- und Einkommensteuer angehoben bzw. auf die überfällige, progressionsbedingte Absenkung verzichtet werden.
Würde
dann nicht alles teurer werden? Die meisten Menschen
kennen sich, was wirtschaftliche Zusammenhänge
betrifft, überhaupt nicht aus. Wenn die Rede ist von
Steuererhöhungen (Monopolsteuer, Mehrwertsteuer), vom
globalem Mindestlohn, Fairtrade und anderen Maßnahmen
(Verbot der Massentierhaltung, Milchpreisgarantie),
befürchten sie gleich eine Teuerungswelle. Sie sehen
halt nur das Belastende, ohne an die positiven
Folgewirkungen zu denken. Bezüglich der
Steuererhöhungen ist der entlastende Faktor (zum
Beispiel die Absenkung der Sozialversicherungsbeiträge)
noch einigermaßen offensichtlich. Schwieriger wird es,
andere Maßnahmen einzuschätzen. So verursachen zum
Beispiel fast alle Subventionen eine empfindliche
Störung der marktwirtschaftlichen
Selbstheilungskräfte. Es kommt zu Fehllenkungen und
unrentablen Investitionen, zur Monopolisierung, zur
Erpressung der Staaten und Arbeitnehmer, während
gleichzeitig die Dividenden und Aktienkurse der
Nutznießer in die Höhe schnellen. Wir wissen heute,
dass die wirtschaftspolitischen Weichenstellungen seit Ende
der 1970er Jahre insgesamt gesehen kontraproduktiv waren
(Senkung der Arbeitseinkommen und Renten trotz Verdoppelung
der Produktivität). Globalisierung, EU und Euro
brachten also nicht das, was uns hoch und heilig von unseren
gewählten Volksvertretern versprochen wurde.
Es gilt, aus den
Fehlern der Vergangenheit zu lernen, nicht aber den
eingeschlagen Irrweg mit allen Mitteln schönzureden und
zu verteidigen. Erfolgversprechende Reformen müssen
ihre Bewährungschance bekommen und dürfen nicht
aus wahltaktischem Kalkül verteufelt werden. Die
engstirnige Angst um die eigenen Pfründe beherrscht
weltweit das politische Denken. Die Furcht, auf ihren
Vorteil bedachte Wähler, Parteimitglieder oder
Großspender zu verprellen, lähmt jegliche
Reformbereitschaft. Unsere Demokratie befindet sich
längst im Würgegriff des Lobbyismus und niemand
scheint ernsthaft bereit, dagegen einzuschreiten.
Ende des 2. Kapitels. Fortsetzung Kapitel 3, Thesen 16-20: Unterentwickelte Staaten fördern!
Impressum
©
Manfred Julius Müller, Flensburg, ins Netz gestellt im Februar
2018

Manfred Julius Müller analysiert seit über 30 Jahren weltwirtschaftliche Abläufe. Er ist Autor verschiedener Bücher zu den Themenkomplexen Globalisierung, Kapitalismus und Politik.
"Only
Fairtrade" (die Zähmung des Kapitalismus) als
Printausgabe... Das
Print-Taschenbuch bietet zusätzliche Vorteile: Bestellung
über Amazon
"Only Fairtrade" gibt es auch in gedruckter Form (leider nur
in der deutschen Originalausgabe).
• Es enthält auch die im Netz fehlenden
Kapitel 4, 5 und 7
• Professionelle Schrift, Blocksatz, bessere
Lesbarkeit.
• Schont die Augen.
• Möglichkeiten, Notizen am Rand zu
vermerken, Hervorhebungen vorzunehmen usw.
• Bessere Übersicht über die einzelnen
Thesen.
• Bleibendes Zeitdokumt (es ist sicher
interessant zu sehen, wie die Öffentlichkeit nach 10
Jahren darüber denkt bzw. was sich bis dahin
durchgesetzt hat).
• Auch ein ideales Geschenk mit jeder Menge
Diskussions-Zündstoff für allle politisch
interessierten Mitbürger.
Das
Taschenbuch können Sie auch in jeder lokalen
Buchhandlung bestellen (und in 1000
Online-Shops).